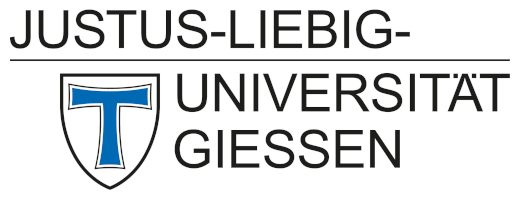Für Forschungsinteressierte
Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS) und komplexe PTBS (kPTBS) entstehen infolge schwerer interpersoneller Traumatisierung und betreffen vielfältige psychologische, soziale und neurobiologische Prozesse. Besonders Traumata in sensiblen Entwicklungsphasen können langfristige Veränderungen auf struktureller und funktionaler Ebene nach sich ziehen. Bisherige diagnostische und therapeutische Ansätze basieren häufig auf statischen Modellen, die der Komplexität psychischer Erkrankungen nach interpersoneller Gewalt nur begrenzt gerecht werden. Die Studie „Leben nach Gewalt“ nutzt dynamische psychologische Netzwerkmodelle, um die Symptomnetzwerke von Gewaltopfern mit PTBS, mit kPTBS und ohne Traumafolgestörung als dynamische, interaktive Systeme zu verstehen und diese um psychologische und biologische Marker zu ergänzen.
Ziel der Studie ist es, ein biopsychosoziales Modell zu entwickeln, das die Dynamik und Vernetzung von Symptomen bei gewaltbetroffenen Personen differenziert abbildet.
Im Rahmen der Studie werden erstmals psychopathologische, psychologische und biologische Daten kombiniert und systematisch über verschiedene Erhebungszeitpunkte hinweg erfasst. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Rolle sozialer Identifikation, der Interaktion zentraler Symptome (z. B. Hyperarousal, negatives Selbstkonzept, soziale Distanziertheit) und dem Einfluss traumaassoziierter Merkmale wie Schwere, Dauer und Zeitpunkt des Erlebens.
Die Erhebung erfolgt im Rahmen eines mehrtägigen Untersuchungsdesigns: Neben zwei anfänglichen Laborterminen mit Fragebögen und klinischen Interviews sowie biologischen Messungen (Blut- und Haarproben) wird über einen Zeitraum von drei Wochen ein intensives EMA-Assessment durchgeführt, bei dem Teilnehmer:innen täglich Informationen zu ihrem psychischen Befinden, ihrem sozialen Kontext sowie aktuellen Stressoren angeben. Auf diese Weise entsteht eine hochwertige, differenzierte Datengrundlage, die es erlaubt, individuelle Muster der Symptomentwicklung zu analysieren und zentrale Einflussfaktoren zu identifizieren.
Die Studie leistet damit einen Beitrag zum tieferen Verständnis komplexer Traumafolgen und schafft zugleich eine empirische Basis für die zukünftige Entwicklung differenzierterer Diagnosemodelle und personalisierter therapeutischer Ansätze.